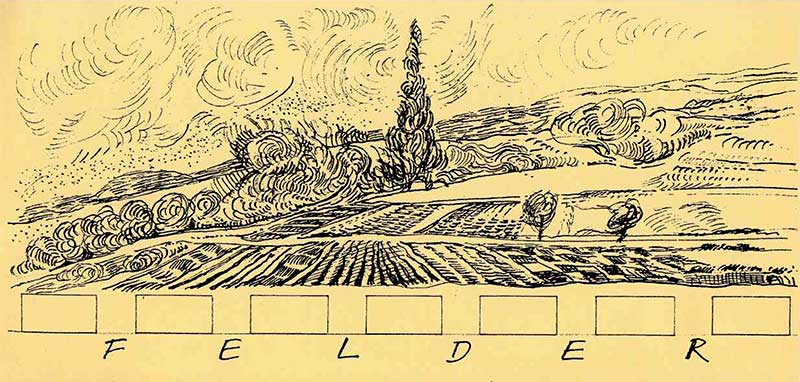Abb. : Wolfgang Ludwig – „Vincent van Gogh zum 150. Geburtstag“. (Einladungskarte zur Ausstellung)
I.
Exakt auf den Tag, ein Jahr nach der Totgeburt eines Knaben selben Namens kommt Vincent, am 30. März 1853 als ältester Sohn des Pfarrers Theodorus van Gogh und dessen Frau Anna Cornelia geb. Carbentus in Groot-Zundert in Nordbrabant zur Welt. Er ist „Erstgeborener“ aber Nachfolger eines bei seiner Geburt verlorenen Sohnes. Vielleicht gründet bereits hier Vincents zutiefst erfahrenes Nicht-zugehörig-sein. Vier Jahre später am 1.Mai 1857 kommt der „Zweitgeborene“, der Bruder Theo zur Welt. Es ist wohl dieses Brüderpaar, welches gemeinsam die Menschheit eine neue Weise, die Welt zu sehen gelehrt hat, in einem Werk, welches unter dem Namen des einen – Vincent van Gogh – in die Kunstgeschichte eingegangen ist. Nicht allein die andauernde finanzielle Unterstützung seit Vincents 27. Lebensjahr, die Versorgung mit Arbeitsmaterial, mit Farben, Pinseln, Leinwänden und was sonst für Zeug zum künstlerischen Handwerk des Bruders sich ernötigte, sondern auch Halt, Ermutigung und sorgende Anteilnahme am Geschick des Bruders – Theo stand dafür ein.
Es war Theo der, noch vor Vincent selber, den Maler im Bruder erkannte und förderte. Seit Vincent sich zu „seinem Weg“ entschlossen hatte, war der Bruder, wie die Korrespondenz zeigt, das alter ego des Malers, dem er nicht nur alles anvertraute, sondern mit dem er gemeinsam denkend, fragend, redend, schreibend und malend existenzielle und künstlerische Selbstklärung leistete, um dieses große Werk hervorzubringen. Noch im letzten Brief des Siebenunddreißigjährigen, den Theo am 29.7.1890, Vincents Todestag, bei ihm fand, heißt es:
„Mein lieber Bruder! Dank für Deinen lieben Brief und für den 50-Francs-Schein, den er enthielt“ So begannen viele der oft täglich, manchmal morgens und dann wieder am Abend des Tages geschriebenen Briefe und in nicht wenigen fehlt ein Gedanke, wie der Verkauf der Bilder gefördert werden könnte.
„Wirklich“, heißt es dann weiter, „wir können nur unsere Bilder sprechen lassen.
Aber trotzdem, mein lieber Bruder, ich sage Dir immer wieder, und ich sage es noch einmal mit dem ganzen Gewicht, das eine hartnäckige Gedankenarbeit verleihen kann – ich sage Dir noch einmal: In meinen Augen bist Du immer etwas anderes als nur ein einfacher Kunsthändler. Durch mich hast Du selber Anteil am Zustandekommen gewisser Bilder, die sogar in aller Verwirrung bestehen können.“ Und nach einer sehr nüchternen Bemerkung über die gespannten Preisverhältnisse zwischen Händlern mit Bildern lebender Künstler und solchen mit Bildern toter Künstler, fügt er hinzu: „Nun meine Arbeit gehört Dir. Ich setze dafür mein Leben ein, und meine Vernunft ist dabei zur Hälfte draufgegangen.“
Vincent hatte sich eine Kugel in die Brust geschossen und starb zwei Tage später an der Verwundung. Zwei Monate danach fiel Theo in geistige Umnachtung und starb endlich am 25.Januar 1891. Beiden, Vincent und Theo, haben wir dieses Werk zu danken, das zu ihren Lebzeiten, bis auf ein Bild, im Handel nicht verkäuflich war.
Theos Witwe Johanna Gesina aber war es schließlich, welche durch geschickte Geschäfts- und Kommunikationspolitik dafür sorgte, dass das Werk als solches überhaupt erhalten und zugänglich, ja zum geschäftlichen Erfolg wurde und zu künstlerischen Weltruhm gelangte.
Heute – gut einhundert Jahre danach – erzielt es die höchsten Preise überhaupt, die für Gemälde im Weltkunsthandel gezahlt werden. Und einer, ein superreicher Japaner, so heißt es, hat sich selbst – wie er wohl glaubte – im Tode in den Rang des ewigen Schönen der Kunst überhöht, als er seinen Leichnam zusammen mit einem Gemälde van Goghs hat einäschern lassen.
II.
Was sich hier zu sagen habe, sage ich nicht als Kunsthistoriker, als Kunstsachverständiger oder Kritiker. Das hat sich mir erschlossen, seit ich mich durch die van-Gogh-Zitate in Wolfgang Ludwigs eigenem malerischen und zeichnerischen Werk habe verleiten lassen, mich auch dem Werk und Dasein Vincent van Goghs auf meine Weise zu nähern, nämlich als philosophierender Soziologe. Ich habe mich gern dazu verleiten lassen.1) Dabei habe ich, Vincents Existenz nach-denkend, den Künstler und seine Kunst zu verstehen versucht. Dies möchte ich Ihnen aus unterschiedlichen Blickwinkeln in vier verschiedenen Hinsichten zeigen.
1. Die erste Hinsicht folgt der Frage: Wovon sprechen wir, wenn wir vom Werk Vincent van Goghs sprechen?
2. Werfen wir einen Blick auf das Leben dieses Mannes. Nicht biographisch, sondern nur hinsichtlich der Entwicklungen, Ereignisse und Einschnitte, welche zeigen, was und wie dieses Leben ist.
3. Dies bereitet ein Verständnis seiner Kunst vor und eröffnet uns die vierte Hinsicht, welche der Frage folgt, was ist das Wesen seiner Kunst?
4. Schließlich fragen wir uns nach der ‚techne‘ des Künstlers. Wie macht er das?
III. Das Werk
Wovon sprechen wir also, wenn wir vom Werk Vincent van Goghs sprechen?
Wir alle kennen van Goghs Werk: Die staunende, lichte Helle der blühenden Obstbäume, der Apfel-, Kirsch- und Mandelblüten; die zur Gestalt der Zypressen sich fügenden Farbwirbel; die Sonnenblumen, welche aus sich selbst zu leuchten scheinen; die wild-knorrigen und wirren Verästungen grün-grau-silberner Olivenhaine und die Olivenpflückerinnen darin; die von den Bauern durchpflügte Erde und der Himmel der sich weit darüber öffnet, durchglüht von der Sonne der Provence und schließlich der Säende und die erntetragenden Getreidefelder unter wirbelnden, mächtig getriebenen Wolken, ausgespannt bis zum fernen Gebirge oder von einem anderen Horizont des Malers begrenzt.
Auch Wolfgang Ludwig zitiert diese Bilder. Er lässt sich von ihrer Kraft leiten, indem er der Weise ihrer Genese, der Art ihres Entstehens bei Van Gogh in ihren zeichnerischen und malerischen Bewegungen nachspürt und ins eigene Schaffen verwandelt, wie das jeder Künstler mit dem Werk seiner Vorgänger und in seiner eigenen künstlerischen Herkunft tut. Kunst entsteht aus Kunst.
Dieses Werk, das wir als van Goghs Werk kennen, aber hat seinen Beginn erst 1887 in Paris. Hier findet der Maler seinen Duktus. Die Gemälde „Selbstbildnis mit Strohhut“ und „Gemüsegärten am Montmartre“, beide vom Pariser Sommer des Jahres 1887, finden Ingo F. Walter und Rainer Metzger in ihrer großen Arbeit über van Gogh, bilden die Zäsur in van Goghs künstlerischem Habitus. Beide Bilder zeigen den deutlichen Einschnitt in van Goghs eigener Entwicklung wie auch gegenüber seinen künstlerischen Vorgängern und Zeitgenossen. Nun wird er beginnen, der van Gogh sein. Da ist er in seinem fünfunddreißigsten Lebensjahr. Vom Sommer 1887 bis zum Sommer 1890, nur drei Jahre hat der Maler sich Zeit gegeben, in sein Werk einzutreten und es zu vollenden. Und wenn wir von dem Werk van Goghs sprechen, meinen wir die Arbeiten, die – bis auf einzelne Ausnahmen – in diesen drei Jahren entstanden sind.
Die Serie der blühenden Bäume kann wohl als der eigentliche Beginn dieses Werkes gesehen werden. Sie entsteht in Arles, im April 1888.
Das „Feld mit Mohnblumen“ welches Anlass der Ausstellung „Van Gogh: Felder. Das Mohnfeld und der Künstlerstreit“ in der Bremer Kunsthalle im Oktober 2003 war, die dreihundertunddreißigtausend Besucher lockte, entstand Anfang Juni 1889 schon in Saint-Remy. Ebenso die „Berglandschaft hinter dem Hospital Saint-Paul und „Grünes Weizenfeld mit Zypresse“. Seine Landschaften mit Olivenbäumen und die „Olivenpflücker“ malte er im November/Dezember des Jahres 1889. Das „Weizenfeld mit Zypressen“ im September 89 und „Zypressen unter dem Sternenhimmel“ bereits in Auvers-sur-Oise, in der Nähe von Paris, seinem letzen Aufenthalt, um nur einige Beispiele zu nennen. Dazwischen liegt eine Fülle von Arbeiten, die wie Vincent sagte, „sogar in aller Verwirrung bestehen können.“ Darunter so berühmte Werke wie „Die Pietà“ nach Delacroix, „Die Auferstehung des Lazarus“ nach Rembrandt oder „Die ersten Schritte“ nach Millet und immer wieder nach Millet, nach Millet.
Die Entelechie dieses Lebens, d. i. die in ihm liegende Kraft, die es zur Wirklichkeit und zur Vollendung bringt, findet ihr ‚telos‘, ihre vollendende und schließlich sich darin halten könnende Begrenzung, in diesen drei Jahren.
Was ist das für ein Leben?
IV. Das Leben
„Ihre Jugend war erfüllt von der Poesie des Brabanter Landlebens; sie wuchsen auf zwischen Kornäckern, Heide und Tannenbusch, in jener eigenartigen und an Empfindungen reichen Sphäre des ländlichen Pfarrhauses, dessen Reiz ihnen während ihres ganzen Lebens in Erinnerung blieb.“
So beschreibt Johanna, Theos Frau, jenes ursprüngliche In-der-Welt-sein der beiden Jungen in ihrer Kindheit. Eine Gesamtheit, ein Horizont ist ihnen eröffnet, innerhalb dessen sie leben und auf die Dinge zugehen können, weil sie zuvor schon, vom Ganzen des In-der-Welt-seins her, mit ihnen vertraut sind. So verstehen sie schon vorab, was die Dinge sind, wie sie zuhanden und zu gebrauchen sind – aber ohne dabei schon jenes Geheimnisvolle verlieren, darin die Dinge in sich selbst ruhen, in ihrem Sein gelassen bleiben, jedem Zuhandensein und jedem Begreifen entzogen.
Mit 16 Jahren, 1869 tritt Vincent – wie man so sagt – ins Leben. Er beginnt eine Lehre als Kunsthändler beim Onkel in Den Haag, in der holländischen Filiale der Firma Goupil & Co. Er arbeitet später für sie in Paris und London. Aber das Ganze geht nicht gut. Der Entlassung durch die Firma zuvorkommend, kündigt er zum 1.4.1876 selbst. In jener Zeit, in London noch, verliebt er sich in die Tochter seiner Zimmerwirtin. Als er Ursula seine Liebe gesteht, weist sie ihn zurück, mit dem Hinweis, dass sie bereits heimlich verlobt sei – mit seinem Vorgänger als Untermieter. Vincent ist tief verletzt.
Nach sieben Jahren Lehr- und Erwerbsarbeit, mit 23 steht er vor dem Nichts. Sein erster Versuch, in der schützenden Gewöhnlichkeit eines – wie man sagt – bürgerlichen Lebens heimisch zu werden, war misslungen. Er hat keinen Beruf und keine Karriere in Aussicht. Brotlos steht er da und weiß nicht, wie es weiter geht. Vincent zieht sich aus der Welt in sich selbst zurück, isst nicht, magert ab, wird sonderlich, zeichnet viel, will aber, wie er von dem damals vielgelesenen Religionswissenschaftler Renan lernt, „sich selbst steigern, große Dinge tun, sich veredeln und über die Gewöhnlichkeit – la vulgarité – erheben, in der die Meisten ihr Leben dahinschleppen“.
„Er will für andere leben“, schreibt der Vater an Theo, „sich nützlich machen, etwas Gutes zustande bringen; wie weiß er selbst nicht – aber im Kunsthandel kann es nicht sein, das weiß er bestimmt.“ Theo schlägt hellsichtig vor, er solle Maler werden, der Vater, er solle sich als Kunsthändler verselbständigen, jedoch nur mit solchen Bildern handeln, die er selbst gut findet.
Vincent entscheidet anders: Lehrer möchte er nun werden. Als Hilfslehrer arbeitet er für Kost und Logis in Ramsgate und Islewood in der Nähe von London. Das ist aber auch nichts. Er wird dann Hilfsprediger bei einem Methodistenpfarrer und spürt eine starke religiöse Berufung. Jedoch, klagt eine Schwester, selber etwas hochnäselnd: „Er denkt, er sei mehr als ein gewöhnlicher Mensch, doch ich finde, es wäre bei weitem besser, wenn er sich für einen gewöhnlichen Menschen hielte.“ Und eine andere Schwester findet: „Er wird stumpfsinnig vor Frömmigkeit.“
Die Familie beschließt, ihm in Amsterdam ein Theologiestudium zu ermöglichen. Vergeblich! Die Vorbereitungen auf das Studium, Griechisch und Latein lernen und vieles mehr – daran scheitert er. Nichts gelingt ihm wirklich. „… wie jämmerlich war das Resultat“, wird er später sagen, „wie besoffen das ganze Unternehmen, wie ungeheuer töricht – es schaudert mich noch jetzt. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens.“ (Brief Nr. 130)
Dann die Aussicht, eine Ausbildung an einer Evangelistenschule in Brüssel zu absolvieren. Drei Monate, August bis Oktober, versucht er das – auch dies vergeblich! Schließlich im Dezember 1878 darf er als Laienprediger in die Borinage, das belgische Steinkohlenrevier, in welchem die Energie für die Industrialisierung Belgiens unter Tage entborgen und zutage gefördert wird.
Offenbar mit allem in eine Art Nachfolge Christi eintretend, lebt Vincent dort. Wie einst im 13. Jahrhundert der reiche Patriziersohn Francesco in Umbrien und Assisi, lebt er das arme Leben Jesu, wohnt in einer Baracke, schläft auf Stroh, gibt das Wenige, was er hat, den Armen. Er glaubt, das Elend der Arbeiter teilen zu müssen und er teilt es mit ihnen. Er besucht sie unter Tage, erlebt das Grauen der Arbeit dort, erlebt ein schweres Grubenunglück und die schrecklichen Folgen eines Streiks der Bergleute, pflegt die Verletzten und Kranken. Nach sechs Monaten, im Juli 1879, jedoch, wird Vincent als Prediger und Evangelist abgelehnt wegen seines, wie seine Missionslehrer meinen, „übertriebenen sozialen Engagements“ und seiner „ungepflegten Erscheinung“ wegen. Aber mehr als das, wird ihnen dieser radikale Evangelist fremd und unheimlich gewesen sein, dem es um einen in mildtätiger Caritas lebendigen Glauben ging. Seine Lehrer hingegen, wünschten sich wohl eine Art Opiumhändler fürs Volk (Marx). Nach den Versuchen als Hilfslehrer und Methodistenprediger ist sein vierter Versuch, sich bürgerlich zu etablieren gescheitert.
Aber hier in der Borinage, unter den „Erniedrigten und Beleidigten“, wie Dostojewski diese eigene Art neuer Menschen nennt, den Bergarbeitern und ihren Familien zeigt sich ihm eine in ihrer Wahrhaftigkeit elementare Menschlichkeit, welche für ihn maßgebend bleibend wird. Sie werden Thema seiner frühen künstlerischen Arbeit. Er schreibt an Theo:
„Die Leute sind hier ungebildet und unwissend und können meistens nicht lesen, doch sind sie zugleich verständig und flink bei ihrer schweren Arbeit und mutig und frei; sie sind klein von Statur, aber ausladend in den Schultern und haben düstere, tiefliegende Augen. Sie sind geschickt in vielen Dingen, arbeiten erstaunlich viel und sind von sehr nervöser Konstitution, ich meine nicht: schwach, sondern fein empfindend. Sie haben einen eingefressenen und eingewurzelten Hass und ein inniges Misstrauen gegen jeden, der den Herren bei ihnen spielen möchte. Bei Kohlenbrennern muss man Kohlenbrennerart und -charakter haben …“
In der Erfahrung des eigenen Elends wie das, jener neuen Menschen – der Bergleute im Kohlerevier – und ihrer zuvor ungeahnten und unvorstellbar Daseinsweise, welche jede Art der Theodizee von vornherein unterläuft, also die Rechtfertigung eines allmächtigen Gottes angesichts des Übels und des Bösen in der Welt, welches er doch zulässt, – in dieser Erfahrung geschieht Vincent etwas, was seine Existenz nachhaltig erschüttert: Es stirbt ihm sein Gott! „Gott ist tot.“ Dieses Diktum Nietzsches erfährt er existenziell. Der bittere Streit zwischen Zweifel und Glauben, den er in jener Zeit zu durchkämpfen hatte, nahm ihm restlos sein früheres Vertrauen in die Wirklichkeit eines transzendenten, christlichen Gott.
V. Hineingehaltenheit in das Nichts
So enden erst ein Mal seine Zugehörigkeits-Versuche, für „andere zu leben, sich nützlich zu machen, etwas Gutes zustande zu bringen“ sich einzugliedern in das alltägliche Leben, in dem doch jeder seinen Platz finden kann. Worauf doch ein Jeder wohl Anspruch hat, auf eine scheinbar sichere, jedenfalls völlig fraglose Weise des Daseins, die er, genauso nötig hat, wie wir alle. Ja, eine Weise des Daseins, der wir alle verfallen sind und die wir benötigen wie eine betäubend-beruhigende Droge, nach der wir dürsten, wie der Trinker nach dem Schluck aus der Flasche, wie der Junkie nach dem nächsten Schuss (Klaus Held) und warum? Weil uns solche „Verfallenheit“ und das „Man“ wie der Denker das nennt, von allen Möglichkeiten der Existenz die fundamentalste zu überdecken und zu verbergen vermag: Die extreme Möglichkeit des Todes, welche droht, alle anderen Möglichkeiten unseres Daseins unmöglich zu machen. Manchmal blitzt sie auf und tiefe, unbestimmte Angst durchfährt uns mit heillosem Schrecken. Aus nichtigstem Anlass ergreift sie uns, unvermutet im Alltag beginnt der Boden unter unseren Füßen zu wanken, aus einem Traum vielleicht wachen wir schreiend auf. Wir erfahren in solcher Angst die ständige Anwesenheit der fundamentalen Möglichkeit des Todes, die Hineingehaltenheit des Daseins in das Nichts. Wir erfahren uns als Sterbliche.
In solchen Momenten fällt alles Fremde und Unechte von uns ab und es bleibt nur das, was einem jeden von uns ausschließlich, unverwechselbar eigen ist, unsere je einzelne Eigentlichkeit. Aber so jäh, wie er aufriss schließt sich der Abgrund des Nichts wieder unter dem Schleier der beruhigenden und vertrauten Alltäglichkeit unseres gewöhnlichen Daseins in der beschützenden Gnade des Man. Und wenn wir uns dann fragen, was es denn war, wovor wir Angst hatten, so können wir es nicht genau sagen, vielleicht etwas verwirrt finden wir, es war eigentlich – nichts.
Eine solche einfache, selbstverständliche und fraglose Daseinsberechtigung, die „Verfallenheit an das Man“ – Vincent van Gogh scheint sie nicht zu haben.
Und in einer ersten Hinsicht können wir die Frage beantworten, was und wie dieses Leben ist: Vincent ist jetzt 26 Jahre alt. Und das ist die Summe seines bisherigen Lebens: Vollständiger Misserfolg beim Versuch, sich in einen Funktionenkreis alltäglicher Nützlichkeit einzugliedern zusammen mit seiner Evangelisten-Erfahrung, dass Gott tot ist. Stattdessen: Erfahrung der Hineingehaltenheit in das Nichts. Ein Dasein am Abgrund. Vincent durchlebt das im Bewusstsein seiner eigenen, vollständigen Nichtigkeit und Nutzlosigkeit. Vincent selbst nicht, niemand mag mehr für ihn einstehen, sogar sein Bruder Theo ist ihm entfremdet. Seine Welt ist zerbrochen, unvertraut – unheimlich – geworden, steht ihm fremd gegenüber.
VI. Entschlossenheit zur Existenz
Im August 1879 kehrt er noch einmal aus der Borinage zurück nach Brüssel. Besucht seinen Pfarrer Pietersen an der Missionarsschule, der auch selbst malt. Vincent bringt seine eigenen Arbeiten mit und berät sich mit ihm. Danach geht er, auf eigene Kosten und ohne Auftrag, zurück in die Borinage. Da kann er, das weiß er, ein Leben fristen. Aber er kommt wohl schon mit dem selbstzweifelnden Vorsatz, es jetzt als Künstler zu versuchen. Dieser Selbstzweifel wird ihn nicht verlassen.
Er mietet sich bei einem Bergman im Dorf Cuesmes ein und beginnt zu zeichnen. „Ich sitze manchmal bis spät in die Nacht hinein und zeichne, um einige Erinnerungen fest zu halten und um Gedanken zu beleben, zu denen mich das Sehen der Dinge unwillkürlich anregt.“ Schreibt er. (Brief 128, S. 314)
Vincent wird sich in dieser neuen Weise des, „die Gedanken belebenden Sehens der Dinge“ zur Existenz in seinem Eigentlichen entschließen, zu seinem Künstlersein. Zur Existenz entschließen – das klingt reichlich pathetisch, ist es aber nicht. Nicht todesmutige, entschiedene Willenskraft des Einzelnen ist hier gemeint. Die Etymologie, also die Bedeutungsgeschichte des Wortes sagt uns vielmehr, ‚entschließen‘ heißt soviel, wie aufschließen, öffnen, befreien, lösen, im mittelhochdeutschen ‚entsliezen’ meint das Wort sogar ‚erklären’. Entschließen und ‚Entschlossenheit‘ stehen im sprachlichen Gegenspiel zu schließen und ‚Geschlossenheit‘.
Aber Entschlossenheit zur Existenz geschieht nicht von selbst. Ein gewisses Wollen, eine Wahl und eine Entscheidung gehören sicher auch dazu.
Vincent: Ich habe „die tätige Melancholie erwählt, soweit ich imstande war, mich zu betätigen, oder, mit anderen Worten, ich habe die Melancholie, die hofft, die strebt und die sucht, derjenigen vorgezogen, die stillschweigend verzweifelt.“
Was tut er? „Wenn Du nun einem Menschen verzeihen kannst, sagt er dem Bruder, dass er Bilder erforscht, dann gib auch zu, dass die Liebe zu den Büchern ebenso heilig ist, wie die zu Rembrandt, ja ich glaube, sogar dass sich beide ergänzen.“
Und wo kommt er an? „Aber auf dem Weg, auf dem ich mich befinde, muss ich weiter gehen, denn wenn ich nichts mehr suche, dann bin ich verloren, dann wehe mir.“
Erforschung der Bilder – alles was er sehen kann und was Theo ihm schicken muss, daneben Lektüre von Charles Dickens, Beecher-Stowe, Victor Hugo, Shakespeare und Griechische Tragödie: Aischylos und einige griechische Klassiker liest er.
Genau so, in „tätiger Melancholie“ öffnet, befreit, löst und entschließt sich Vincent zur Existenz. In den etwa zehn Monaten, zwischen 15.Okt. 1879 (Brief 129) und 20. August 1880 (Brief 131) vollzieht sich das für ihn. Der Brief 130 (ohne Datum) dokumentiert es. Das ist literarisch, aber auch philosophisch anspruchsvoll gedacht und berückend schön zu lesen. Nicht allein findet er in diesen neun Monaten zu seiner Kunst, sondern das In-der-Welt-sein als Ganzes verwandelt sich ihm. Er erfährt es nun als das herakliteische „Eins ist Alles“ (hen kai pan). Das geschieht jetzt ihm – Vincent van Gogh, dem Künstler.
Aber das ist jetzt Einer, der über den Abgrund sich eine Brücke baut. Einer, der die Möglichkeit der Nichtigkeit des Daseins im Ganzen erfahren und in ihrer unausweichlichen, untergründigen Gegenwärtigkeit und Anwesendheit erkannt hat und sich anschickt, fernerhin darin zu leben. Dasein – Hineingehalten in das Nichtsein sagen ihm nun dasselbe. Das ist jetzt Einer, der die Angst überwunden hat, weil er mit ihr leben wird. Ein solches Dasein ist – gerade angesichts der eingesehenen Möglichkeit des Nichtseinkönnens – als verstehendes Seinkönnen, dem es in solchem Sein um dieses als das eigene geht. (vgl. Sein und Zeit. S. 231) Solches Dasein, das sich verstehen kann, als das, was und wie es ist, heißt Existenz.
So verwandelt sich Vincent das “ Eins ist Alles “ zugleich in das herakliteische „Eine in sich Unterschiedene“, (hen diapheron eanto) in welchem neben der unendlichen Fülle aller Möglichkeiten, immer zugleich die beiden extremen Möglichkeiten im Widerstreit geborgen und bereit sind – das Sein zusammen mit dem Nichts.
Einem, der sich solchermaßen zur Existenz entschließt, der öffnet sich. Er tritt aus der tödlichen Enge und Verschlossenheit seiner Welt, wie aus einem Käfig heraus und dem kann sich in heller Freude staunend – je und je – das täglich neue Wunder erschließen, das „überhaupt Seiendes ist und nicht vielmehr Nichts“ (Heidegger). Dem erschließt sich das Seiende im Ganzen neu. Dem sind alle Dinge verwandelt und die Welt als Ganze in ein neues Licht gerückt und „alle Dinge neu geworden“ wie Vincent sagt.
VII. Vincents Brief an Freunde der Menschen
Genau so beschreibt er das in jenem Brief 130 an Theo, und so darf ich nun, anders als Wolfgang Ludwig, Vincent auf meine Weise zitieren:
Es gibt, sagt er, Müßiggänger vieler Art, aber auch solche wie er einer ist, „den Müßiggänger, den Nichtstuer wider Willen, der innerlich von einem großen Verlangen zur Tat verzehrt wird,
… so einer weiß nicht einmal immer selbst, was er tun könnte, aber er fühlt doch instinktiv: Ich tauge zu etwas, ich habe eine Existenzberechtigung, ich weiß, dass ich ein ganz anderer Mensch sein könnte! Womit könnte ich nützlich sein, wozu könnte ich dienen?
…
Und wenn du es richtig findest“, schreibt er Theo, „dann magst Du mich auch für einen solchen (Müßiggänger W.K.) halten! Ein Vogel im Käfig weiß sehr gut im Frühling, dass es etwas gibt, wozu er tauglich wäre, er fühlt sehr wohl, dass er etwas tun sollte, aber er kann es nicht ausführen.
Was ist es doch gleich? Er erinnert sich nicht mehr recht; er hat nur eine dunkle Ahnung, sagt sich: ‚Die anderen bauen ihre Nester, haben ihre Jungen und ziehen ihre Brut auf.‘ Dann zerschlägt er sich den Schädel am Gitter des Käfigs, aber der Käfig bleibt, und der Vogel ist wahnsinnig vor Schmerz.“
…
„Und die Menschen sind oft nicht in der Lage, etwas zu tun, sind Gefangene in irgendeinem Käfig, was der Schrecken aller Schrecken ist.“
…
„Man kann nicht immer sagen, was es ist, das einen einschließt, mit einer Mauer umgibt und einen zu begraben scheint, aber man fühlt doch irgendeinen Riegel, ein Gitter, Mauern.
Ist das alles Einbildung, Phantasie? Ich denke nicht, und dann fragt man sich: Mein Gott, geht das noch lange so, immer in alle Ewigkeit?
Weißt Du“, sagt er zu Theo, „was das Gefängnis verschwinden lässt?
Jede ernste, tiefe Neigung, Freund sein, Bruder sein, lieben, das öffnet das Gefängnis mit souveräner Macht, mit übermächtigem Zauber.
Wer aber nichts dergleichen hat, verharrt im Tod.“
„… Aber man muss mit einer hohen und innig ernsten Sympathie lieben, mit Willen und Intelligenz, und man muss immer trachten, eingehender, besser und mehr zu wissen, das führt zu Gott, das führt zum unerschütterlichen Glauben.“
VIII. Ein verwandelter Gott
So findet Vincent in seiner erlösenden Entschlossenheit wieder einen Gott, einen Glauben, sogar einen unerschütterlichen. Aber auch sein Gott hat sich ihm verwandelt. Das ist jetzt ein anderer Gott, nicht mehr der christliche Gott, der transzendente, jenseitige, ohnmächtige, „allmächtige Vater“, an den „zu glauben unglaubwürdig geworden ist“, wie Friedrich Nietzsche sagt. „…ich bin eine Art Gläubiger in meinem Unglauben.“ sagt Vincent und versucht Theo zu erklären:
…
„Jemand hätte für kurze Zeit den unentgeltlichen Kursen der großen Hochschulen des Elends beigewohnt und hätte geachtet auf die Dinge, die er mit seinen Augen sieht und mit seinen Ohren hört und er hätte darüber nachgedacht – auch er würde dahin kommen, zu glauben, und er würde vielleicht mehr lernen, als er je sagen könnte.“
„… was die großen Künstler, die ernsten Meister, in ihren Meisterwerken sagen, Gott wird darinnen (anwesend W.K.) sein.“
Das ist ein anderer, kein metaphysischer, jenseitiger Gott mehr. Das ist eine neue Art, an griechische Götter erinnernder Gott, ein anwesender Gott, der sich in allem Einzelnen, was ist, als Überwältigendes „mit souveräner Macht, mit übermächtigem Zauber“ zeigen kann und zeigt. Solch Göttliches zeigt sich Vincent in den Werken der „ernsten Meister“. Es ist das überwältigende Ereignis des Schönen. Aber nicht als Ästhetik des Gefälligen, sondern als Ereignis des Schönen in seiner Wahrheit und rauen Wahrhaftigkeit. Das ist Vincent wohl zum ersten Mal im Gemälde „Die Kartoffelesser“ von 1866 gelungen, dem einzigen Werk, das er selbst als Kunstwerk seiner frühen Zeit, noch vor Paris, gelten lässt.
Und nun lässt sich in einer zweiten Hinsicht ein weiteres Mal die Frage beantworten, was und wie dies es Leben ist.
Die Liebe, welche in jenem „hohen, innig ernsten Sinn mit Willen und Intelligenz“ liebt, zu der sich Vincent hin öffnet und aus seiner Verschlossenheit entschließt, beginnt sein In-der-Welt-sein als Ganzes zu tragen. Das geschieht in der Weise, zu lernen, die Helle der Unverborgenheit des Seins im einzelnen Seienden zu sehen, zu hören und zu fühlen. Es ist denkendes, vernehmendes Sehen was und wie die Dinge in ihrem Gelassensein, ihrem unbegreiflichen Geheimnis, der Wahrheit ihres Seins selbst sind. Das macht dieses Leben jetzt aus: Es eröffnet sich seinem In-der-Welt-sein als ganzem ein völlig neuer Horizont, welcher nun seine Existenz, sein Künstlersein als ganzes eröffnet und begrenzt.
IX. Existenz: Lebenskunst
In solcher Einsicht in die Existenz Vincent van Goghs erschließt sich uns auch die Antwort auf unsere dritte Frage: Was ist das Wesen dieser Kunst?
Und dies ist seine Kunst: „Ich kenne noch keine bessere Definition für das Wort Kunst, als diese:<<L’Art, c’est l’homme ajouté à la nature qu’il dégage>>. Die Kunst, das ist der Mensch, zur Natur hinzugefügt, welche er befreit.“ Die Natur, – „doch mit einer Bedeutsamkeit, mit einer Auffassung, mit einem Charakter, die der Künstler erst hervorhebt.“ sagt er im Juni 1897 (Brief 127) Eine Bedeutsamkeit, die er erst ins Helle bringt und so sichtbar werden lässt. Und man möchte mit den Worten des Denkers hinzufügen: Eine Bedeutsamkeit, in welcher der Künstler das Seiende als solches im Ganzen aus der Verborgenheit im Dunkel in die Unverborgenheit, ins Lichts „her-vor-hebt“ und in seinem Sein sich zeigen lässt. Das ist ganz und gar griechisch gedacht! Das ist „techne tou biou“, Kunst des Lebens. Die Lebenskunst des Aristoteles. Lebenskunst, in einem sehr ernsten Sinn.
Lebenskunst – und diejenigen unter uns, welche Aristoteles sehr lieben, mögen mir verzeihen, wenn ich diesen Übersprung wage – Lebenskunst: Das ist eine Art der existenziellen Vermählung von Kunst und Leben, welche das Leben im Ganzen künstlerisch erneuert und als Kunstwerk – als Lebenskunst gestaltet. So schickt sich Friedrich Nietzsche zur selben Zeit wie Vincent in seinem Werk „Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik“ (1871), diesen Gedanken des antiken Philosophen neu zu denken. Nietzsche glaubte, diese alles verwandelnde Einheit von Kunst und Leben in der Musik Richard Wagners schon erfahren zu haben. Vincent van Gogh lebt bereits so – kein Theater!
„Der Weltgrund ist ein tragisch-dionysischer Abgrund“, sagt Nietzsche. Dieser Abgrund zeigt sich uns als Chaos und Grauen. Ihm weichen wir aus in den Schein der Beständigkeit des Alltäglichen, der Wissenschaften, der Religionen, der Weltanschauungen, der Wertesysteme, Wertegemeinschaften und dergleichen mehr. Wir kennen das schon als die rettende wohlig-rauschhafte Betäubtheit der „Verfallenheit“ und des „Man“.
Oder aber, – wir entschließen uns zu unserer, wie Vincent sich entschloss, zur seiner Wahrheit des Seins, zu seiner tragisch-dionysischen Existenz in der alles ergreifenden Möglichkeit des Künstler-Seins, weil ein anderes Sein für dieses Daseins nicht mehr möglich ist. Der tragisch-dionysische Abgrund, wie Nietzsche das nannte, allein ist unausweichlicher Grund seiner Existenz als Künstler geworden, in der ein Leben des Menschen van Gogh nicht mehr zu unterscheiden ist: Dasselbe ist Einheit von Kunst und Leben. Aber anders als Nietzsche, der sich darunter eine Art künstlerisch verwandelte Auferstehung ursprünglich eleusinischen oder paradiesischen Seins alles Seienden im dionysischen Rausch erträumte, ist die Einheit von Kunst und Leben Vincents Existenz, aber auf eine ganz andere Weise.
„Kunst ist ein Kampf – in der Kunst muss man seine Haut dransetzen. Es geht darum, wie zehn nackte Neger zu arbeiten. Ich würde lieber nichts sagen, als mich schwächlich auszudrücken.“ Diesem Wort von Millet folgt Vincent in seiner Kunst bis zum Schluss. „Ich setze dafür mein Leben ein, und meine Vernunft ist dabei zur Hälfte draufgegangen“, heißt es in Vincents letztem Brief.
So, genau so, seit jenem Sommer 1879 in der Borinage lebt Vincent sein Künstlersein – in tragisch-dionysischer Ekstase. Zehn Jahre hat er jetzt noch zu leben. Sieben Jahre davon lernt er, der zu werden, der er ist. Im April 1888 in Arles ist er das geworden, hat er es erreicht sein, ‚telos‘, das ist die er-grenzende, voll-ständige, voll-endete Existenz seines Künstlerseins. Die Entelechie seiner Existenz erfüllt sich. Er er-schöpft sie. Dafür gibt er sich noch 17 Monate Zeit. Dann hat er das In-der-Welt-sein dieser Existenz restlos ausgeschöpft.
An Gaugin schreibt er in diesen Tagen: „Es ist die Ehrlichkeit des Naturempfindens, die unsere Hand führt, und wenn diese Erregung manchmal so stark ist, dass man arbeitet, ohne zu merken, dass man arbeitet – wenn manchmal die Pinselstriche kommen, und sich aneinanderfügen, wie die Worte in einem Gespräch oder in einem Brief, so darf man nicht vergessen, dass es nicht immer so gewesen ist und dass auch in Zukunft viele niederdrückende Tage ohne jede Inspiration kommen werden.“
In diesen wenigen Monaten, vom April 1888 bis zum Juli 1890 entsteht jenes berühmte Werk Vincent van Goghs, das wir alle kennen.
Das ist Vincents Kunst in Arles im April 88 in der Serie der blühenden Obstbäume:
„Frühmorgens habe ich an einem blühenden Pflaumenbaum gearbeitet. Plötzlich erhob sich ein furchtbarer Sturm. Das gab einen Effekt, wie ich ihn noch nirgends sonst gesehen, und in gewissen Abständen kam er immer wieder – zwischendurch die Sonne, in der alle kleinen weißen Blüten glänzten. Es war unglaublich schön.“ (Brief 460)
„Hier ist die Skizze eines Baumes, den ich genauer ausgeführt habe für Dich, zum 1. Mai. Das Bild ist ganz und gar hell und in einem Zug herunter gemalt. Auf dem ersten weißen Blütenbüschel sitzt die Farbe ganz dick und wild mit wenig Gelb und Lila.“ (Brief 462)
„Lieber Theo! Ich stecke in einer wahren Arbeitswut. Die Bäume stehen in Blüte und ich möchte einen richtigen provencalischen Obstgarten mit seiner hinreißenden Heiterkeit fertigkriegen. Dir mit ruhigem Kopf zu schreiben, ist also nahezu unmöglich.“ (Brief 457)
Das ist Vincents „dionysischer Rausch“, die helle Freude und das Staunen darüber, dass überhaupt Seiendes ist und nicht vielmehr Nichts.
Die ekstatische Freude an der Welt, welche sich in der Suche nach der „Ehrlichkeit der Naturempfindung“ in allen seinen Bildern dieser Zeit zeigt, erinnert sehr an die griechische Suche nach Wahrheit. Wahrheit nannten die Griechen ‚aletheia’, das heißt ‚Unverborgenheit‘, Unverhülltheit, ein ins Helle-ziehen der Wahrheit des Seins des je und je Seienden inmitten seiner üppigsten Vielfalt und preiszugeben, was und wie es ist. Die Dinge erstrahlen in ihrer eigenen Helle, wie in ihrem eigenen Licht. „Alles zeigt sich in einem frischen Glanz, der uns die ganze Welt schön erscheinen lässt und in dieser Schönheit scheint die Ordnung dieses Ganzen alles Seinenden auf: der Kosmos“. (Klaus Held) Diese schöne, in der Fülle des Seienden aufscheinende Ordnung kann nur gesehen, geschaut werden. Sie zeigt sich. Sie kann uns jedoch allenthalben begegnen und zeigen, alltäglich und auf ebenso elementare Weise, wie die Möglichkeit des Todes und des Nichts. Schlagartig geht sie uns auf wie ein Ereignis. Wie durch einen Blitzschlag erhellt, zeigt sich uns diese Ordnung des Schönen, manchmal im einfachsten und vielleicht nebensächlichsten Seienden – einem Paar ausgetretener Schuhe etwa, oder einem Feld im Sonnenglanz des eben innehaltenden Regenschauers, einem Strauß Sonnenblumen. Vincent malt das! Er malt im Ereignis des Schönen im alltäglichen Seienden. Das ist Vincents dionysisches Fest der Wahrheit des Seins. Seine neue Weise des „Gottesdienstes“ – das ist seine lebendige Kunst. Bei diesem dionysischen Fest wird jedes Mal dieselbe Frage gestellt: Was scheint da auf, was ist das Eine, der Urgrund, das Prinzip, das sich selbst Gleichbleibende in der unendlichen Fülle alles und jedes einzelnen Seienden, seines Werdens und Vergehens? Und – je und je – neu entbirgt sich, nicht etwa die eine universelle und ewige Wahrheit des Seins, nein es entbirgt sich die ebenso unendliche Vielfalt der Wahrheit des Seins in der Vielfalt des Seienden. Die Griechen nannten dieses Schauen, dem solches aufscheint, ‚theorein‘. Daraus leitet sich, seines griechischen Ursprungs wenig bedenklich, unser Wort Theorie ab. Für die Griechen ist ‚theorein‘ gerade dieses staunende Schauen, in dem sich die Ordnung des Schönen in ihrer aletheia, ihrer Unverborgenheit enthüllt. In diesem Sinne waren „die Griechen geradezu wahrheitssüchtig“. (Klaus Held) Das, genau das, ist Vincent auch! Vincent ’schaut‘ malend. Seine Malerei ist ‚schauen’ im griechischen Sinne des ‚theorein’. Das ist das Wesen seiner Kunst.
„Ich sehe, dass die Natur zu mir gesprochen, dass sie mir etwas gesagt hat, was ich in Schnellschrift aufgeschrieben habe. In meiner Schnellschrift mögen Worte sein, die nicht zu entziffern sind – doch etwas ist geblieben von dem, was der Wald oder der Strauch oder die Figur gesagt haben.“
X.
Und nun wollen wir uns in den vierten und letzten Blickpunkt stellen, welcher unter der Frage steht: Wie gelingt ihm das? Was macht die ‚techne‘ aus, so nannten die alten Griechen die Geschicklichkeiten und das Wissen um die Weisen des Her-vor-hebens und Her-vor-bringens im hervorbringend gestaltenden Tun. Wie macht Vincent das und wie können wir selbst das sehen?
Von den Impressionisten, Monet, Degas, Renoir, die ihm in seinen beiden Pariser Jahren begegnen, übernimmt er den phänomenalen Realismus. Die Wirklichkeit sollte ohne gedanklichen Umweg über den Intellekt das Auge passieren und den reinen Eindruck auf dem Bild hinterlassen. Jene Art des Sehens – der Philosoph Edmund Husserl nennt sie ‚phänomenologisches Sehen’ -, welches unter Ausschluss der Intentionen des Bewusstseins zu den Sachen selbst zurückfinden und sie in ihrem Sein, ihrem „wahren Wesen“, schauen möchte, das lernte er hier.
Mit Toulouse-Lautrec, dem Maler der Freudenmädchen und Bordelle, des Absinthrausches und der rauschenden Vorstadtbälle, teilt er den klaren Blick auf die elementare Wahrhaftigkeit des Menschen in allen seinen Daseinsmöglichkeiten und Abgründigkeiten.
Von den Pointilisten, vor allem Georges Seurat, leiht er sich die Gegenstandlosigkeit der Maltechnik. Nämlich die neue Art, winzige Farbpunkte, gestaltlos selbst und in ihrer zufälligen Gestalt bedeutungslos, nicht Zeichen, nicht Bedeutung, mit dem Pinsel zu setzen; lediglich Farbpunkte, Farbstriche aus den Grundfarben, deren Kombination und Mischung, Verdichtung und Verdünnung kommen auf die Leinwand.
Von der japanischen Kunst leiht er sich die lichte Leichtigkeit ihrer Aquarelle und Holzschnitte.
Aber das allein ist noch nicht der Vincent van Gogh in der Eigentlichkeit seines Künstler-Seins. Erst das Licht, die Helle wird sich ihm verwandeln. Durch das Herausnehmen der Schatten aus den Bildern gelingt ihm das. Das zeigen zuerst die blühenden Bäume vom Frühjahr 1888. Nicht mehr von Außen, wo immer auch herkommend, werden die Dinge beleuchtet, nein sie erstrahlen in ihrem eigenen Licht, das aus ihnen selbst zu kommen scheint. Auch da, wo sparsam Schatten gesetzt sind, muten diese Stellen dunklerer Tönung an, als würden sie vom Stamm und den Zweigen selbst geworfen, die das Leuchten der Blüten einrahmen – eine solche Helle, welche das Sein der Dinge im Malen erhellt und darin zugleich sich selbst erhellt ist ein Ereignis der Wahrheit des Seins. Diese Weise des Malens, wie sie Vincent sich fügt, ist denkendes Schauen dessen, was und wie die Dinge selbst in ihrem Sein sind. Diese Weise des Sehen-lassens kann, wie der Denker sagt, „Lichtung des Seins“ genannt werden.
All das übernimmt er und verwandelt es. So findet Vincent seinen eigenen Duktus. Er malt, wie wenn er den Kraftlinien einer ekstatisch erfahrenen Wahrheit des Seins folgte. Erregt in der Energie der Wahrhaftigkeit der Naturwahrnehmung in ihren Kraftfeldern hingerissen, in Wirbeln explodierend und in Energieknoten zusammenstürzend, malt er seine berühmten Bilder. In einem anderen, neuen Horizont der miteinander und gegeneinander streitenden Mächte fügt sich ihm Kunst und Welt in eins.
Nicht mehr ‚Ansicht‘ ist das Ergebnis, ‚idea’, wie Platon das nennt, sondern ‚ergon’, das heißt Werk, wie Aristoteles sagt, das im tätigen, lebendigen Geschehen des denkend vernehmenden Schauens und Malens allein wirklich ist und sich in den Turbulenzen der Farbflecke, Linien und Wirbel erst zum Ganzen des Bildes fügt. Wie in diesem Geschehen das Werk mit dem Künstler zusammen steht und nur als solch Ganzes wirklich ist, erzwingt das Werk dasselbe Geschehen auch vom Betrachter, der so, um es sehen zu können, in den Blickpunkt des Malers eintreten muss. Das Geschehen zwingt ihn das Werk jedes Mal neu zum Ganzen des Bildes zu fügen. Es zwingt ihn zusammen mit dem Bild in jenes Geschehen der Wahrheit. In dieser besonderen ‚in sich unterschiedenen Einheit‘ vollzieht und enthüllt sich jedes Mal neu die Wahrheit dieser Einheit. Sie kann geschaut werden. Das kann jedes Mal anders sein oder einen anderen Aspekt des Wesens der Sache zeigen. Es kann aber auch gar nicht geschehen – es muss gesehen werden können.
„Um von der Provence eine Vorstellung zu geben, sagt Vincent, ist es unerlässlich, noch ein paar Bilder von Zypressen und Bergen zu machen.“ (Brief 604) „Der Olivenbaum ist wechselnd wie unsere Weide im Norden. Die Weiden sind auch sehr malerisch, sehen aber eintönig aus. Der Baum entspricht vollkommen dem Charakter der Landschaft. Dieselbe Wichtigkeit, die bei uns die Weide hat, besitzen hier die Zypressen und Olivenbäume. Was ich gemacht habe, ist neben ihren Abstraktionen etwas hart und grob realistisch. Trotz dem gibt es vielleicht das Charakteristische der Landschaft wieder, und man wird die Erde darin fühlen.“ (Brief 599)
So überwältigt ihn ganz unvermutet das eigentümliche Wesen dieser Landschaft, welche erst unter dem, was der erste Blick noch verbirgt entborgen und vom Künstler eigens Her-vor-gehoben werden muss, weil es sich ihm jetzt zeigt, er das jetzt sehen kann.
„Gerade an den Tagen aber, wo man es am wenigsten vermutet, findet man ein Motiv, das sich neben den Arbeiten unserer Vorgänger sehen lassen kann. Man lernt dann eine Landschaft kennen, deren Wesen ganz anders ist, als es auf den ersten Blick erscheint.“ (ebenda)
„Ich bin die ganze Zeit beschäftigt, den Charakter der Kiefern, Zypressen usw. in dieser reinen Luft hier zu beobachten, die Linien, die sich nicht verändern und die man auf Schritt und Tritt wiederfindet.“ (Brief 604)
Diese neue Art, zu malen erfordert eine ebenso neue Art des Sehens auch für das Publikum. Nicht mehr passives Nachahmen und Anschauen des Abgebildeten – Mimesis –, sondern ‚poiein’, wie die Griechen sagten. Das ist aktives, gestaltendes her-vor-hebendes, her-vor-bringendes Sehen des Ganzen der Dinge, was und wie sie sind.
Dieses aktive her-vor-hebende, her-vor-bringende Sehen ist die Art zu sehen, welche die Brüder van Gogh die Menschheit gelehrt haben. Sie hat fast ein Jahrhundert gebraucht, es zu lernen.
Seit den Fünfzigern hängen manche ‚VanGoghs‘ in den Küchen und Wohnstuben der Menschen. Die Brücke von Langlois in Arles, die Fischerboote in Les Saintes-Maries oder die Sonnenblumen, immer wieder die Sonnenblumen, so hängen sie neben Dürers „Kaninchen“ oder seinen „betenden Händen“. Dies liegt ganz im Sinne Vincents: „Wenn man überdauern will, muss man ebenso bescheiden arbeiten wie ein Bauer. Besser als flüchtige Ausstellungen zu machen“, findet er, „wäre es, sich ans Volk zu wenden, damit jeder bei sich zu Hause Gemälde oder Reproduktionen hätte, die Lehren sein könnten, wie das Werk von Millet.“
Anmerkung:
1) In Jahre 2002, als wir gemeinsam die Hamburger Ausstellung „Vincent van Gogh – Die Pariser Zeichnungen“ besuchten, kündigte Wolfgang M. Ludwig an, dass er für den 30. März 2003 eine Ausstellung eigener Werke zum 150. Geburtstag Vincent van Goghs vorbereiten wolle. Wir entwickelten dann die Idee, eine gemeinsame Würdigung des großen Künstlers zu versuchen, jeder auf seine Weise, er im Medium des Zeichnens und der Kunst, ich im Medium des Sprechens und des Denkens. Dieser Essay ist zuerst am 30. März 2003 in Hannover als Vortrag gehalten. Er ist mein Beitrag zur „Ausstellung = Vincent van Gogh zum 150. Geburtstag = mit Bildern von Wolfgang M. Ludwig, die van-Gogh-Bilder zitieren“.
Wolfgang M. Ludwig ist 1949 in Peine in Niedersachsen geboren.
Er hat ein Studium des Vermessungswesens absolviert; er ist also ein Mann des Maßnehmens, der genauen Beobachtung und der präzisen Darstellung. In den Jahren 1976 – 1978 studierte er freie Kunst in Braunschweig an der Hochschule für Bildende Künste bei Arwed D. Gorella. Seit 1978 lebt und arbeitet er als freier Künstler in Langenhagen bei Hannover. Seitdem hat er in zahlreichen Ausstellungen sein Werk präsentiert. Es kann hier nicht der Ort sein, das künstlerische Herkommen und die eigene kreative Leistung des Künstlers zu würdigen, dessen Werk selbst einen eigenen Essay wert ist, aber seine künstlerisch sehr enge Beziehung zu Vincent van Gogh, die auch für meinen Essay beziehungsreich ist, soll hier wenigstens angedeutet werden.
Genau dies, der „grobe“ Realismus „neben der Abstraktion“ wie Vincent an Theo schreibt, und die „Linien, die sich nicht verändern und die man auf Schritt und Tritt wieder findet“, sind ein besonderes Thema in Vincents Kunst, aber sie sind ein besonderes Thema auch im malerischen und zeichnerischen Werk von Wolfgang M. Ludwig. Sie sind das Thema dieser Ausstellung zu van Goghs 150. Geburtstag. In seinem schöpferischen Nachspüren der malerischen und zeichnerischen Bewegungen Vincents, welche diesen Linien zugrunde liegen und der Energie, die sie treibt, lässt uns im Werk von Wolfgang M. Ludwig auch das Werk van Goghs neu erfahren und verstehen.
Der Hildesheimer Künstler und Kunstpädagoge Prof. Dr. Ulrich Teske hat diese „Verwandtschaft“ der beiden Künstler gesehen und uns von einer „Begegnung zwischen Volfgang und Wincent berichtet, wie er sie als Augenzeuge aufgezeichnet hat“.
Es heißt dort:
„Wincent und Volfgang
Nach einem Wort von André Malraux verdankt die Kunst der Kunst immer mehr als der Natur, aber das wissen wir schon und können deshalb Wincent und Volfgang bei der Arbeit zuschauen.
Wincent sitzt auf seinem mageren Klapphöckerchen am Feldrand, auf den Knien liegt diese schartige Pappe, darauf das blanke Papier. Linke Hand das braune Tuschefläschchen, rechts die Rohrfeder. Licht von vorn, rote Augen unter dem Strohhut. Eintauchen. Die Feder setzt auf. Strich, Strich, Kurve, schnell. Jetzt die Schraffen. Dieser Baum fängt mit einem Haken an. Die roten Augen wandern. Die Hand geht wie von selbst.
Volfgang steht dunkel, klein und zusammengenommen rechts hinter Wincent und sieht ihm über die Schulter. Wie geht das? Was macht denn der mit der Landschaft? Ich bin Vermessungstechniker. Dies ist Gelände. Ich kann auch zeichnen. Volfgang bleibt. Die Augen klappen groß und braun vor dem Motiv. Bei Volfgang sieht man, was er sieht. Was hat Wincent gesehen? Wo ist er jetzt? Etwas fehlt hier. Die Landschaft ist immer noch da.
Blick herunter vor die Füße. Links am Rande des Augenfeldes die drei Abdrücke des Klapphöckerchens im Lehm wie von Hufen eines kranken Tieres. Und da liegt es, wie breitbeinig aus einer Schürze hingeschüttet: da die kurzen Striche auf einem Haufen, die bösen Haken verstreut daneben, die beginnende Schmeichellinie, unfügsame Bündel von Parallelschraffen, Tintenspur, Flecken, das alles liegt hier noch am Boden. Volfgang sammelt das auf und tut alles in seine Tasche.
Zurück in die Zeichenwerkstatt, die Treppen hoch. Volfgang schüttet seine Tasche auf einem Papier aus. Da liegen die Striche, Linien, Haken und Schraffen. Volfgang sortiert. Wie ging das noch? Wincent wo bist du? Ich mach’ dir dein Bild noch mal.
Wir wissen, dass die Kunst der Kunst mehr verdankt als der Natur: Wie Künstler arbeiten, wissen wir nicht genau. Nur, dass Wincent auf seinem mageren Klapphöckerchen am Feldrand gesessen hat und das Volfgang dunkel, klein und zusammengenommen hinter ihm gestanden hat, das ist gewiss. Hannover den 21. September 1995.“
Literatur:
Ingo F. Walter, Rainer Metzger, Vincent van Gogh Sämtliche Gemälde, 2 Bde. Köln
1993
Klaus Held, Die Welt und die Dinge, in: Christoph Jamme und Karsten Harries (Hrsg.): Martin Heidegger. Kunst – Politik – Technik, München 1992
Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 161986, insbesondere die §§ 27, 38 – 40 sowie 46 – 53,
Hannover, 18. 4. 2003